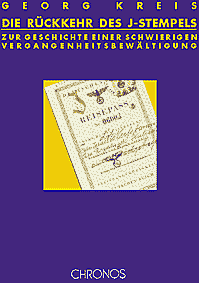- Kurztext
- Autor/in
Der für den deutsch-schweizerischen Grenzverkehr 1938 eingeführte J-Stempel hat drei Geschichten: eine Vorgeschichte, eine Nachgeschichte und eine Gegenwartsgeschichte. Die Geschichte seiner Gegenwart ist die wichtigste. Hier muss nachgewiesen werden, welche Menschen unter welchen Umständen wegen dieses Stempels an der Flucht vor ihren künftigen Mördern gehindert wurden. Es gibt diese Geschichte, wir kennen sie jedoch kaum. Die Vorgeschichte dagegen ist die bisher am stärksten beachtete und am heftigsten diskutierte und betrifft die Verhältnisse und Vorgänge, die zur Regelung von 1938 geführt haben. Warum zum J-Stempel eine Nachgeschichte? Es entspricht einem akademischen Interesse zu untersuchen, wie der J-Stempel historiografisch verarbeitet wurde. Dieser Längsschnitt kann die verschiedenen Positionen sichtbar machen und sagt zum Teil mehr aus über die Kommentatoren als über den Gegenstand. Eine Auseinandersetzung mit der Nachgeschichte erweist sich neuerdings auch als gesellschaftspolitisch nötig. 1997/98 ist im rechtsbürgerlichen Milieu eine Bewegung aufgekommen, die mit einiger Resonanz das bestehende Geschichtsbild zu revidieren versucht. Durch sie ist die Behauptung in Zirkulation gesetzt worden, der Schweiz werde seit mehr als vierzig Jahren immer wieder «fälschlicherweise» vorgehalten, für den J-Stempel verantwortlich zu sein. Die Studie zeigt, dass eine partielle Revision der personalisierten Schuldzuweisung keineswegs zu einer Entlastung der Schweiz führt. Die Schweiz wird allen revisionistischen Bemühungen zum Trotz den J-Stempel nicht los, er gehört zu ihrer Vergangenheit. Man kann sich aber darum bemühen, dass die darin zum Ausdruck kommende Mentalität kein bestimmendes Element ihrer Gegenwart ist. In den Jahren nach 1945 war der J-Stempel kein Thema. Erst über mehrere Etappen 1954, 1967 und 1973, dann 1994/95 erhielt er einen festen Platz im kollektiven Gedächtnis. Der Revisionismus der jüngsten Zeit hat auf diese wachsende Präsenz reagiert und damit diese Präsenz nur noch verstärkt.