Aus dem Wanderbuch eines Heimatlosen
Herausgegeben und mit Nachworten von Christa Baumberger und Nina Debrunner
- Kurztext
- Autor/in
- Einblick
- In den Medien
- Buchreihe
- Downloads
Albert Minder (1879–1965) hat als Erster in der Schweiz das Leben seiner heimatlosen Vorfahren erforscht und erzählt. Seine Familiengeschichte bietet anschauliche Einblicke in eine nichtsesshafte Kultur und beschreibt die Armut in der Schweiz des 19. Jahrhunderts. Eindringlich und mit Humor erzählt, ist die «Korber-Chronik» ein wichtiges Zeugnis einer literarischen Selbstermächtigung. Sie behandelt so zeitlose und aktuelle Themen wie Herkunft, Familienbande, Arbeit und Armut.
Mit Minder lässt sich eine Geschichte der Schweiz «von unten» entdecken: Er gibt fahrenden Heimatlosen und Bauernfamilien im Berner Seeland eine Stimme, beschreibt aber auch den Überlebenskampf der armen Stadtbevölkerung in Bern und Burgdorf sowie die Arbeitswelt im Gefängnis und in Tabakfabriken. Indem er seine privaten Erinnerungen mit den politischen Ereignissen der Zeit verknüpft, schafft er ein lebendiges Bild des 19. Jahrhunderts.
Die kommentierte Neuausgabe der «Korber-Chronik» (1947) erschliesst den historischen Kontext und die Wirkungsgeschichte und stellt erstmals den Autor Albert Minder vor. Der Band wird ergänzt mit Gedichten und einem Auszug aus «Der Sohn der Heimatlosen» von 1926. Albert Minder tritt als engagierter Vertreter einer Schweizer Arbeiterliteratur in Erscheinung.
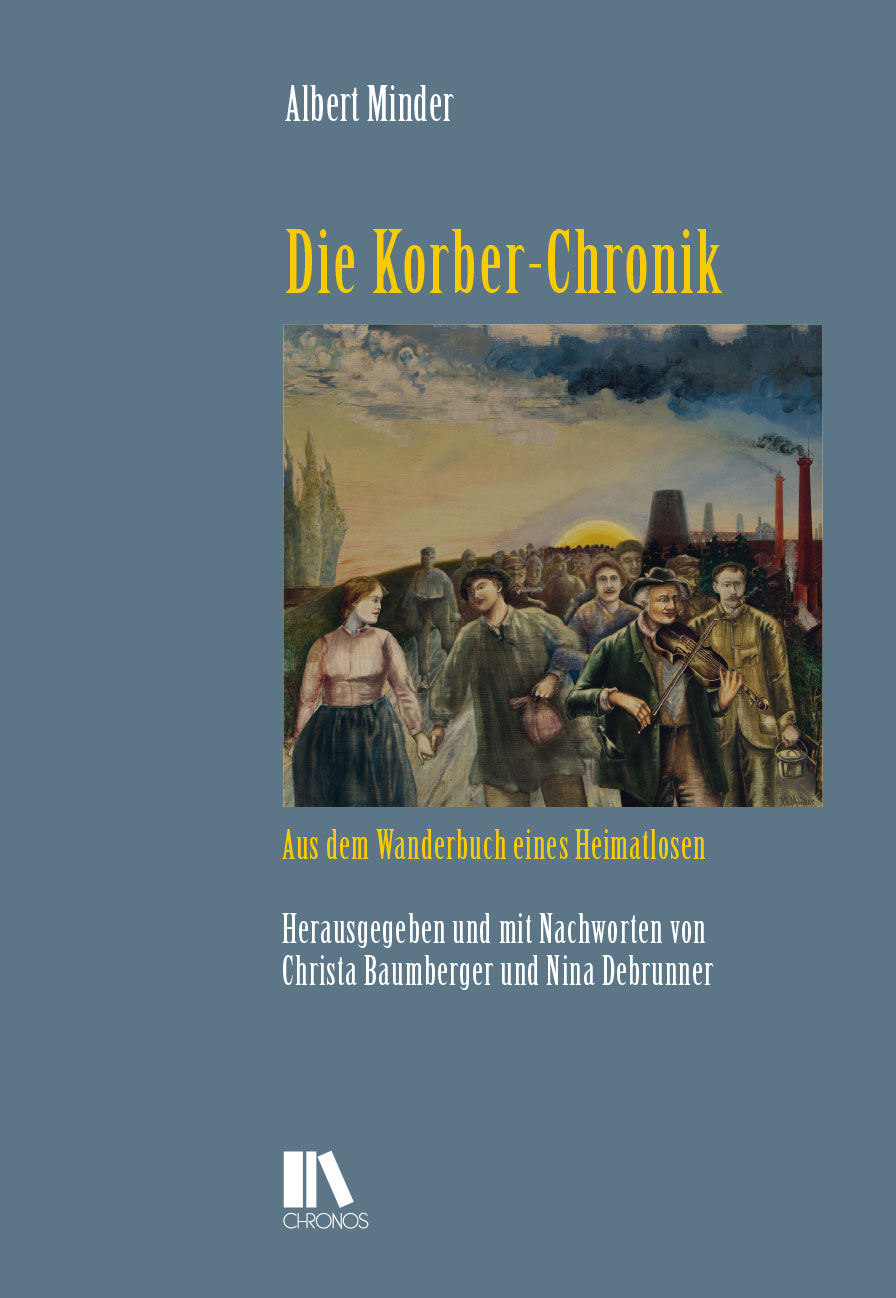
«Seine Familiengeschichte beschrieb [Albert Minder] 1947 in der ‹Korber-Chronik›. Sie gilt als eines der wichtigsten literarischen Zeugnisse der nichtsesshaften Kultur. Zugleich ist sie eine scharfsinnige und humorvoll geschriebene Sozialstudie der Schweiz des 19. Jahrhunderts. Jetzt wurde das längst vergriffene Werk neu aufgelegt.»
«Auch nach dem 1. Mai ist dieses Buch aus dem Chronos-Verlag lesenswert. Albert Minder verstand sich als Arbeitsdichter. Doch mit der ‹Korber-Chronik› hat er zugleich ein höchst lebendiges Zeitdokument mit persönlich geprägten Einblicken in ein rundes Jahrhundert der Schweizergeschichte geliefert. […] Mit dieser Episode sei signalisiert, dass die ‹Korber-Chronik› kein trockenes Traktat ist, sondern ein Lesevergnügen.»
«Der Autor zeichnet die Armut im 19. Jahrhundert in allen Facetten. Er tut dies anschaulich, mit dramatischen Alltagsepisoden, lässt Humor und Ironie zwischen die Zeilen einfliessen. Und er tut es sprachgewandt. Etwa mit mundartlichen Wortkreationen von ‹armmüetelig› für armselig bis ‹zusammenhebig› für sparsam. Das Glossar der Herausgeberinnen birgt manche Entdeckung.»
Zur Besprechung
«Die Zürcher Neuedition ist ein grosser Verdienst, denn Albert Minder war nicht nur ein engagierter Anwalt der Armen, sondern auch ein Chronist der Nichtsesshaftigkeit im Berner Seeland. Der Autodidakt beschreibt in seinem Werk nicht zuletzt den mitunter bitteren Alltag seiner Vorfahren. Er gibt den fahrenden Heimatlosen und Landarbeiterfamilien eine Stimme, schildert aber auch den Überlebenskampf der Stadtbevölkerung in Bern und Burgdorf sowie die Arbeitswelt im Gefängnis und in Tabakfabriken. Er betrieb dazu intensive Archivstudien (leider ohne Quellenangaben) und betätigte sich als eigentlicher Historiker.»
Zur Rezension
«In der 1947 erstmals erschienenen ‹Korber-Chronik›, die jetzt in einer kommentierten Neuausgabe erscheint, tritt der Erzähler als ‹Kläger gegen die hartherzige Gesellschaft› auf, sein Ton ist aber nicht hasserfüllt, sondern sachlich, zuweilen sogar humorvoll. […] Minder wollte in der ‹Korber-Chronik› über die Rekonstruktion seiner Familiengeschichte hinaus auch das Alltagsleben der besitzlosen Leute im 19. Jahrhundert dokumentieren. Mit authentischen Erlebnissen bietet er sozusagen eine Innenansicht und entfaltet ein Zeitpanorama, das auch eine Schweizer Geschichte ‹von unten› ist.»
«Albert Minder (1879–1965) war der Nachfahre einer nicht-sesshaften Familie, die sich vor allem mit der Arbeit als Korbflechter, als ‹Korber›, über Wasser zu halten versuchten. Minder schaffte es dank ausgezeichneter Leistungen aufs Gymnasium, plante Lehrer zu werden – und scheiterte doch an den für ihn unerschwinglichen Kosten für Lehrmittel und Unterkunft am Lehrerseminar. Er wurde dann Schriftenmaler und verfolgte eine eigene Mission, indem er seine Familiengeschichte festzuhalten und zu publizieren begann. Es geht in seinen zwei Büchern ‹Der Sohn der Heimatlosen› (1925) und ‹Die Korber-Chronik› (1947) um Herkunft und Familie, um Arbeit und Armut. […] Die Strukturen machten es einem Albert Minder schwer, der etwas erreichen wollte. Also wurde er zum Chronisten seiner eigenen Familiengeschichte. ‹Selbstermächtigung› würde man das heute nennen. Selber erzählen. Das Narrativ über die Armen und gesellschaftlich Ausgegrenzten – die ‹Verschupften›, wie sie bei Minder heissen – verändern.»