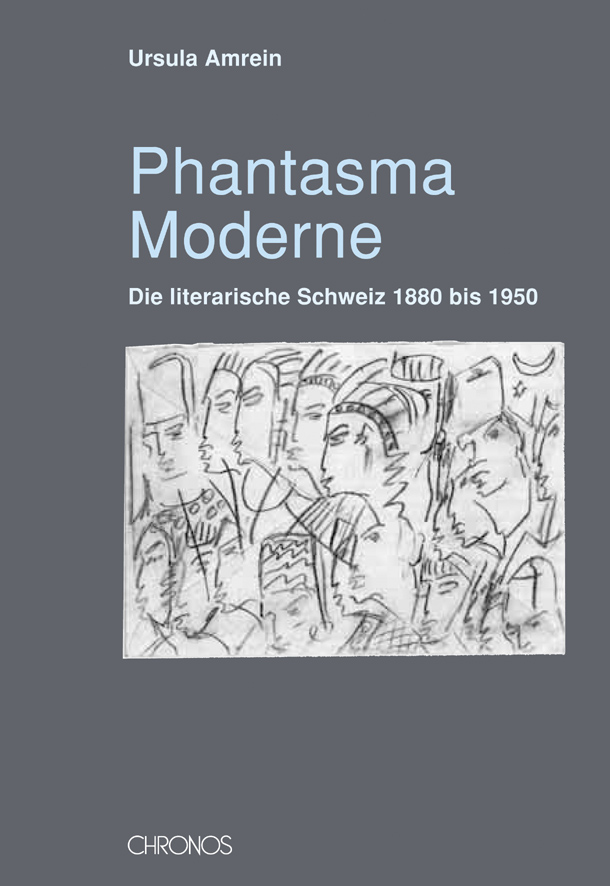«Der Band zeigt beispielhaft auf, wie unsinnig das plane Reden von einer «Nationalliteratur» ist, wenn das kulturelle und politische Gefüge instabil und die Literatur – eine vormals ästhetische Grösse – zur Mitarbeiterin der geistigen Landesverteidigung wird.»
NZZ
- Kurztext
- Autor/in
- Einblick
- In den Medien
Mit der Ausdifferenzierung der Moderne um 1900 gewinnen phantasmatische Bilder verlorener Ganzheit an Bedeutung. Der vorliegende Band fragt nach der Funktion solcher Bilder für die
kulturelle Identität der Schweiz. Der Fokus ist dabei auf die Literatur der deutschsprachigen Schweiz in ihren vielfältigen Kontexten gerichtet. Zur Diskussion stehen die Entfaltung des Paradigmas ›Schweizer Literatur‹ im Spannungsfeld von Großstadt und Provinz, die Vermittlung des Politischen im Medium der Literatur, die Ideologisierung des Gegensatzes von National- und Weltliteratur sowie die Kulturpolitik der geistigen Landesverteidigung. Kontroversen um Else Lasker-Schüler und Thomas Mann vergegenwärtigen die Situation der literarischen Emigration. Die Karrieren von Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt geben Einblick in die Formierung der Nachkriegsmoderne.
Der Band zeichnet ein Porträt der literarischen Schweiz zwischen 1880 und 1950 und trägt zum vertieften Verständnis einer Epoche bei, die kulturell durch die Moderne und ihre Gegenbewegungen, politisch durch die Katastrophe zweier Weltkriege geprägt ist.
kulturelle Identität der Schweiz. Der Fokus ist dabei auf die Literatur der deutschsprachigen Schweiz in ihren vielfältigen Kontexten gerichtet. Zur Diskussion stehen die Entfaltung des Paradigmas ›Schweizer Literatur‹ im Spannungsfeld von Großstadt und Provinz, die Vermittlung des Politischen im Medium der Literatur, die Ideologisierung des Gegensatzes von National- und Weltliteratur sowie die Kulturpolitik der geistigen Landesverteidigung. Kontroversen um Else Lasker-Schüler und Thomas Mann vergegenwärtigen die Situation der literarischen Emigration. Die Karrieren von Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt geben Einblick in die Formierung der Nachkriegsmoderne.
Der Band zeichnet ein Porträt der literarischen Schweiz zwischen 1880 und 1950 und trägt zum vertieften Verständnis einer Epoche bei, die kulturell durch die Moderne und ihre Gegenbewegungen, politisch durch die Katastrophe zweier Weltkriege geprägt ist.
Inhalt
Nationale Grenzziehung, kulturelle Identifikation. Der doppelte Ort der Schweizer Literatur 1880 bis 1950
Großstadt und Moderne. Literarische Inszenierungen und poetologische, Kontroversen um 1900
Von Goethes Stiltypologie zur Stilkritik der Nachkriegszeit. Antimoderne Dichtungstheorien vor und nach 1945
Die schwierige Beziehung zwischen Kunst und Politik. Das Schauspielhaus Zürich als Exilbühne und als Theater der Nation
Geistige Landesverteidigung. Die Anfänge der schweizerischen Kulturpolitik
Das »Jüdische« als Faszinosum und Tabu. Else Lasker-Schüler und Thomas Mann im Schweizer Exil
Ästhetik der Distanz. Klassik und Moderne in der Dramaturgie von Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt
Großstadt und Moderne. Literarische Inszenierungen und poetologische, Kontroversen um 1900
Von Goethes Stiltypologie zur Stilkritik der Nachkriegszeit. Antimoderne Dichtungstheorien vor und nach 1945
Die schwierige Beziehung zwischen Kunst und Politik. Das Schauspielhaus Zürich als Exilbühne und als Theater der Nation
Geistige Landesverteidigung. Die Anfänge der schweizerischen Kulturpolitik
Das »Jüdische« als Faszinosum und Tabu. Else Lasker-Schüler und Thomas Mann im Schweizer Exil
Ästhetik der Distanz. Klassik und Moderne in der Dramaturgie von Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt
Pressestimmen
«Weil in ihm einige der eher unerquicklichen Seiten der Moderne ins helle Licht gerückt werden, sollte er als ein wichtiger Beitrag auch zur Mentalitätsgeschichte schweizerischer Eliten verstanden werden.»
Anett Lütteken, Schweizer Monatshefte
Besprechungen
Literarische Schweiz
rox. Im Nachhinein muss man sagen: Es war eine genialische Fügung, dass sich das Bild der Schweiz um 18. Jahrhundert literarisch unter die Idee der Unversehrtheit hatte stellen lassen. Die Schweiz: ein zivilisationsfernes Alpenland, sittlich intakt und besiedelt von einfachen und beherzten Bergbewohnern, deren Sinne noch empfinden konnten und deren Gesit ein Hort der Freiheit war. Das ist in der Tat eine literarische Denkfigur, aber immerhin eine, die lange anhält: Noch bei Thomas Mann und sogar bei Walter Benjamin finden sich im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts Lobreden auf die Schweiz als jenes «andere Deutschland», das nicht dem grossdeutschen Imperialismus anheimgefallen war und noch immer eine Art Nistplatz für eine bodenständige Antimoderne bot. Doch wie sehen die literarischen Beziehungen zwischen der Schweiz und Deutschland wirklich aus, wenn die Klischees einmal beiseitegelassen werden? Ursula Amrein, Privatdozentin für neuere deutsche Literatur an der Universität Zürich, hat genauer hingeschaut. Denn was man so schnell als «Schweizer Literatur» bezeichnen mag, hat just in den Jahren zwischen 1880 und 1950 ein ganz komplexes, alles andere als homogenes Erscheinungsbild. Zum einen ist die Schweiz durchaus nicht nur ein Hort der Antimoderne, des Weiteren gibt es grosse innerhelvetische Spannungen, die sich auch literarisch niederschlagen. Nach 1933 wird die Denkfigur einer «Schweizer» Literatur – angesichts der deutschen Exilliteratur und der Frage der politischen Zukunft der Schweiz – erst recht kontrovers. Der Band zeigt beispielhaft auf, wie unsinnig das plane Reden von einer «Nationalliteratur» ist, wenn das kulturelle und politische Gefüge instabil und die Literatur – eine vormals ästhetische Grösse – zur Mitarbeiterin der geistigen Landesverteidigung wird.
Publiziert mit freundlicher Genehmigung der NZZ.
Neue Zürcher Zeitung, 19./20. Januar 2008