Die aus dem Ghetto Theresienstadt Befreiten in der Schweiz: Lebenswege und Erinnerungen
- Kurztext
- Autor/in
- Einblick
- In den Medien
- Downloads
Am 7. Februar 1945, kurz vor der Kapitulation Deutschlands, erreichte ein Rettungstransport mit 1200 Jüdinnen und Juden aus dem Ghetto Theresienstadt St. Gallen. Angestossen hatte die Befreiungsaktion 1944 das Schweizer Ehepaar Recha und Yitzchok Sternbuch, das die Unterstützung von Jean-Marie Musy fand. Der katholisch-konservative Altbundesrat trat mit dem Reichsführer SS Heinrich Himmler, den er persönlich kannte, in Verhandlungen ein. Himmler versprach sich einen Reputationsgewinn NS-Deutschlands bei den Westalliierten und veranlasste die Zusammenstellung des Transports.
Wer waren die Menschen, die durch diese Aktion in die Schweiz gelangten? Wie erlebten sie die Auswahl für den Transport und ihren Aufenthalt in der Schweiz? Wohin migrierten sie nach Kriegsende weiter? Welchen Platz nimmt die Befreiungsaktion in ihren Erinnerungen ein? Einem biografischen Ansatz folgend, wird die Geschichte dieser Rettungsaktion erstmals mit einem Fokus auf die Befreiten erzählt. Ihre Perspektiven werden anhand von Tagebüchern, Memoiren, Briefwechseln, Postkarten, Zeitzeug:inneninterviews und Poesiealben analysiert.
Ergänzt wird die Studie durch systematische soziodemografische Informationen zu den Befreiten, die aus Flüchtlingsakten des Schweizerischen Bundesarchivs gewonnen werden, sowie durch die Perspektiven der Schweizer Behörden, von Häftlingen im Ghetto Theresienstadt, die sich gegen eine Teilnahme am Transport entschieden, und von Schweizer:innen, die mit den Befreiten in Kontakt kamen.
- Die Befreiung der 1200 Häftlinge aus dem Ghetto Theresienstadt im Kontext der schweizerischen FlüchtlingspolitikS. 19–54
- Zusammenstellung, Organisation und Verlauf des TransportsS. 55–94
- Ankunft in der SchweizS. 95–130
- Unterbringung in Quarantäne- und AuffanglagernS. 131–150
- Nachkriegsmigration: Heimkehren, weiterreisen, bleiben?S. 151–186
- Erinnerung an die Befreiungsaktion und RezeptionS. 187–214
- Edith Freund Kramer: «Ärztliche Hilfe war kaum möglich, aber man konnte ihnen psychisch beistehen […]». Lebenssinn und Lebenswege einer jüdischen ÄrztinS. 217–240
- Camilla Hirsch: «Nur gesund muss man bleiben, und das ist Glücksache.» Gesundheit und Krankheit im Ghetto Theresienstadt und in der SchweizS. 241–264
- Joachim Bagainski und Robert Narewczewitz: «I felt really good being with a man in uniform and being allowed to be photographed with him». Fotografische Darstellungen aus dem Schulhaus Hadwig und Erinnerungen der Kinder an den Aufenthalt in der SchweizS. 265–290
- Carolina Josephus Jitta, Debora Frenkel und Herman Emile Frenkel: «Weil ich nach deutscher Auffassung jüdischer Abstammung bin.» Jüdisch? Protestantisch? Konfessionslos? Religiöse Identitäten und religiöse Praxis niederländischer Häftlinge aus dem GhettS. 291–318
- Helena Kovanicová und Petr Fiala: «[N]o longer in immediate deadly danger, but […] still not free.» Fragmente der Freiheit in den Erinnerungen von zwei Holocaustüberlebenden aus der TschechoslowakeiS. 319–348
- Gerda Schild Haas: «What am I doing now to […] justify my saving?» Umgang mit den Verfolgungs- und Befreiungserfahrungen im «Leben nach dem Überleben»S. 349–374
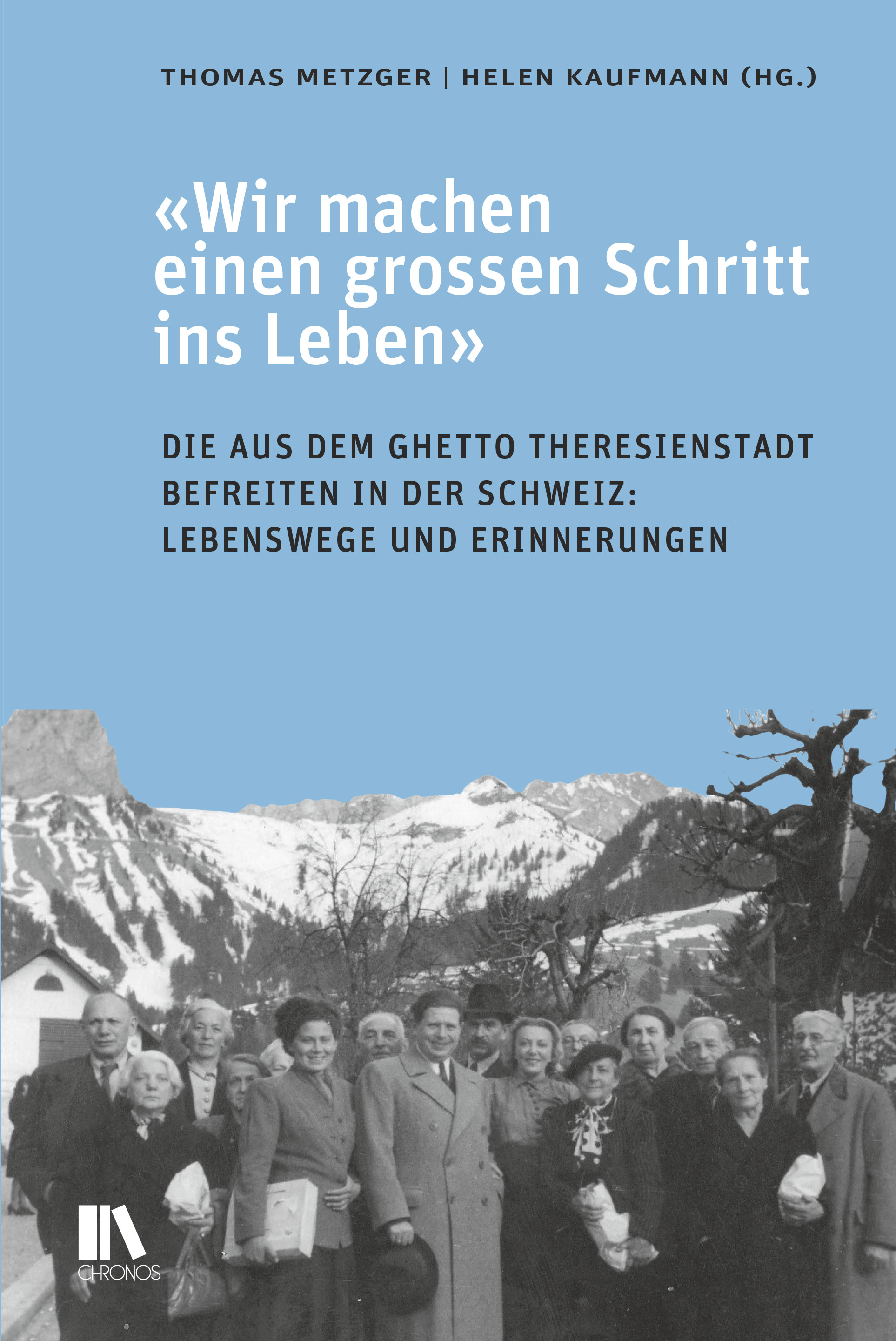
«Die […] Publikation erzählt diese Auslöseaktion jüdischer Opfer als transnationale Geschichte des Überlebens, in deren Fokus das Schicksal und die Erinnerungen der von Gewalt und Rettung Betroffenen selbst stehen. […] Thomas Metzger und Helen Kaufmann ist ein gut gelungenes, klug fokussierendes, im Blick nie einengendes Buch zu verdanken. Angereichert ist diese Publikation mit Fotografien, unter ihnen vierzig Bilder des St. Galler Pressefotografen Walter Scheiwiller.»
Zur Rezension
«Thomas Metzger und Helen Kaufmann haben zusammen mit weiteren Historiker:innen zum 80. Jahrestag dieser Rettungsaktion ein Buch herausgegeben, das Planung und Ablauf der Aktion, den Kontext von 1945, die Rezeption sowie ausgewählte Fallstudien zu Beteiligten umfasst. So bin ich in wohlbekannter Nachbarschaft auf Abgründe der Weltgeschichte gestossen.»
«Der Historiker Thomas Metzger hat, zusammen mit Helen Kaufmann und weiteren Mitarbeiterinnen, die Hintergründe und die Geschichte des Transports aus Theresienstadt im vor kurzem erschienenen Buch ‹Wir machen einen grossen Schritt ins Leben› umfassend aufgearbeitet. Das Buch beschreibt, wie es zum Transport kam und dessen Verlauf, was in St.Gallen geschah, wie die Geretteten behandelt wurden und wie es mit ihnen weiter ging. Kurz werden auch die Schweizer Flüchtlingspolitik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und das Ghetto Theresienstadt dargestellt. Hinzu kommen ein Kapitel über die Erinnerung an die Befreiungsaktion und deren Rezeption, sechs biografische Fallstudien und ausführliche Quellenangaben. Angereichert ist das Buch mit Fotografien, unter ihnen 40 des St.Galler Pressefotografen Walter Scheiwiller.»
Zur Rezension
«Darin schildern Helen Kaufmann, Thomas Metzger und sechs weitere Autorinnen aus der Schweiz, aus Tschechien und Österreich die aussergewöhnliche, bisher kaum beachtete Rettungsaktion vor achtzig Jahren und ihre Hintergründe. Grundlage für den Haupttext sowie für die biografischen Fallstudien im zweiten Teil bildeten Tagebücher, Briefe oder Zeitzeugen-Interviews.»