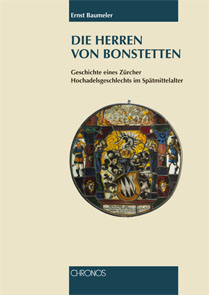«Das in Satz, Layout, Graphik und Einband sehr ansprechend gestaltete Buch widmet sich ‹einem kleinen Adelsgeschlecht mit vergleichsweise beschränkten personellen, wirtschafltichen und machtpolitischen Ressourcen› und will ergründen, wie es dieser Familie möglich war, über alle politischen, wirtschaftlichen und sozialen Umbrüche hinweg ihre Stellung zu behaupten.»
Kurt Andermann, Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins
- Kurztext
- Autor/in
- Einblick
- In den Medien
- Downloads
Die Herren von Bonstetten entstammen dem Hochadel, und noch heute führen Nachkommen diesen Namen fort. Ursprünglich im Dorf Bonstetten am Albis ansässig, residieren die Freiherren seit dem 13. Jahrhundert auf der Burg Uster. 1534 übersiedeln sie in die Stadt Zürich. 1606 stirbt der hier untersuchte Zürcher Zweig aus.
Obwohl nur ein kleines Adelsgeschlecht mit wenigen Angehörigen, gelingt es den Bonstettern durch kluges Politisieren und mit einer geschickten Heiratspolitik ihre Herrschaft zunächst unter Habsburg und anschliessend unter den Eidgenossen jahrhundertelang zu bewahren. Als enge Vertraute der ersten Habsburger Könige bekleiden Bonstetter nach 1273 Spitzenämter als Reichs- und Landvögte in Zürich, im Thurgau und Aargau sowie als Abt von St. Gallen. Zielgerichtete Ehen mit Berner und Zürcher Patrizierfamilien ermöglichen ab dem 15. Jahrhundert den Anschluss an die Führungsschichten und die Beteiligung an der Staatsführung der beiden mächtigsten eidgenössischen Orte.
Obwohl nur ein kleines Adelsgeschlecht mit wenigen Angehörigen, gelingt es den Bonstettern durch kluges Politisieren und mit einer geschickten Heiratspolitik ihre Herrschaft zunächst unter Habsburg und anschliessend unter den Eidgenossen jahrhundertelang zu bewahren. Als enge Vertraute der ersten Habsburger Könige bekleiden Bonstetter nach 1273 Spitzenämter als Reichs- und Landvögte in Zürich, im Thurgau und Aargau sowie als Abt von St. Gallen. Zielgerichtete Ehen mit Berner und Zürcher Patrizierfamilien ermöglichen ab dem 15. Jahrhundert den Anschluss an die Führungsschichten und die Beteiligung an der Staatsführung der beiden mächtigsten eidgenössischen Orte.
Inhalt
Einleitung
1. Auf den Spuren der Herren von Bonstetten im Mittelalter
1.1. Zürcher Hochadel
1.2. Die bisherige familiengeschichtliche Forschung
1.3. Das Wappen der Herren von Bonstetten
2. Die Herren von Bonstetten im 13. Jahrhundert. Aufstieg zu Vertrauten der ersten Habsburger Könige
2.1. Das historische Umfeld
2.2. Familie, Verwandte, Freunde
2.3. Bonstetter Besitz
2.4. Bonstetter als Vertraute der Habsburger Könige
2.5. Die Kirche im Leben der Herren von Bonstetten
2.6. Beobachtungen, Ergebnisse und Zusammenfassung
3. Die Herren von Bonstetten im 14. Jahrhundert. Von Vertrauten des Königs zu Gefolgsleuten der Herzöge von Habsburg
3.1. Das historische Umfeld
3.2. Familie, Verwandte, Freunde
3.3. Bonstetter Besitz und Ökonomie
3.4. Bonstetter Karrieren im Dienst der Habsburger Herzöge
3.5. Die Kirche im Leben der Herren von Bonstetten
3.6. Ergebnisse und Zusammenfassung
4. Die Herren von Bonstetten im 15. Jahrhundert. Vom habsburgischen Adligen zum adligen Eidgenossen
4.1. Das historische Umfeld
4.2. Familie, Verwandte, Freunde
4.3. Bonstetter Besitz und Ökonomie
4.4. Vom habsburgischen Adligen zum adligen Eidgenossen
4.5. Die Kirche im Leben der Herren von Bonstetten
4.6. Ergebnisse und Zusammenfassung
5. Die Herren von Bonstetten im 16. Jahrhundert. Vom Zürcher Landadligen zum regimentsfähigen adligen Stadtbürger
5.1. Das historische Umfeld
5.2. Familie, Verwandte, Freunde
5.3. Bonstetter Besitz und Ökonomie
5.4. Ein Adliger in Zürichs Staatsführung
5.5. Ergebnisse und Zusammenfassung
Schlusswort
1. Auf den Spuren der Herren von Bonstetten im Mittelalter
1.1. Zürcher Hochadel
1.2. Die bisherige familiengeschichtliche Forschung
1.3. Das Wappen der Herren von Bonstetten
2. Die Herren von Bonstetten im 13. Jahrhundert. Aufstieg zu Vertrauten der ersten Habsburger Könige
2.1. Das historische Umfeld
2.2. Familie, Verwandte, Freunde
2.3. Bonstetter Besitz
2.4. Bonstetter als Vertraute der Habsburger Könige
2.5. Die Kirche im Leben der Herren von Bonstetten
2.6. Beobachtungen, Ergebnisse und Zusammenfassung
3. Die Herren von Bonstetten im 14. Jahrhundert. Von Vertrauten des Königs zu Gefolgsleuten der Herzöge von Habsburg
3.1. Das historische Umfeld
3.2. Familie, Verwandte, Freunde
3.3. Bonstetter Besitz und Ökonomie
3.4. Bonstetter Karrieren im Dienst der Habsburger Herzöge
3.5. Die Kirche im Leben der Herren von Bonstetten
3.6. Ergebnisse und Zusammenfassung
4. Die Herren von Bonstetten im 15. Jahrhundert. Vom habsburgischen Adligen zum adligen Eidgenossen
4.1. Das historische Umfeld
4.2. Familie, Verwandte, Freunde
4.3. Bonstetter Besitz und Ökonomie
4.4. Vom habsburgischen Adligen zum adligen Eidgenossen
4.5. Die Kirche im Leben der Herren von Bonstetten
4.6. Ergebnisse und Zusammenfassung
5. Die Herren von Bonstetten im 16. Jahrhundert. Vom Zürcher Landadligen zum regimentsfähigen adligen Stadtbürger
5.1. Das historische Umfeld
5.2. Familie, Verwandte, Freunde
5.3. Bonstetter Besitz und Ökonomie
5.4. Ein Adliger in Zürichs Staatsführung
5.5. Ergebnisse und Zusammenfassung
Schlusswort
Pressestimmen
«In knappen, aber treffsicheren Strichen zeichnet der Verfasser den Weg der Familie durch die Jahrhunderte. […] Er hat damit der Adels- und Landesgeschichte im Einflussbereich Zürichs aber auch im südwestdeutschen Raum gute Dienste geleistet. Darüber hinaus bekommen dadurch die genealogisch arbeitenden Forscher ein Musterbeispiel für eine gute und umfassende Aufarbeitung einer Adelsfamilie vorgestellt.»
Immo Eberl, Genealogie – Deutsche Zeitschrift für Familienkunde
«His ability to analyze and extract a coherent picture from sources that even by the standards of this period are fragmentary and self-contradictory is impressive. Altogether, this is an excellent book in terms of its content and structure.»
David Nicholas, Mediaevistik
«Die flüssig geschriebene, sorgfältig recherchierte und sich durch eine umfassende Auswertung auch der archivalischen Wuellen auszeichnende Monographie bietet einen überaus detaillierten Einblick in die Geschichte dieses Adelsgeschlechtes. Zahlreche Karten, Besitzverzeichnisse und Stammbäume tragen zur Illustration bei. […] So bleibt es ein Nachschlagewerk, dessen sich andere Forschende für weitergehende, vergleichende Forschungen zum Hochadel bzw. höheren Niederadel besonders auch innerhalb der Territorien eidgenössischer Städte mit grossem Gewinn bedienen werden.»
Christian Hesse, Zeitschrift für Historische Forschung
Besprechungen
Dass innerhalb der eidgenössischen Orte noch weit bis in die Neuzeit hinein alte Adelsgeschlechter ihre Herrschaft ausübten, wird gern übersehen, denn es passt nicht in das gängige Geschichtsbild von der Vertreibung des Adels durch die freiheitsdurstigen Schweizer. Für die Grafen von Thierstein hat Dorothea Christ bereits 1998 gezeigt, wie diese sich mit der neuen politischen Situation im Raum der nachmaligen Schweiz arrangierten und zwischen Kooperation und Konkurrenz mit den Eidgenossen lavierten (Dorothea Christ, Zwischen Kooperation und Konkurrenz. Die Grafen von Thierstein und ihre Standesgenossen in ihren Beziehungen zur Eidgenossenschaft im Spätmittelalter, Zürich 1998). Zu ähnlich gelagerten Ergebnissen gelangt nun Ernst Baumeler in seiner Dissertation über die Freiherren von Bonstetten, die sich in der Nachbarschaft der expandierenden Stadt Zürich während rund vier Jahrhunderten an der Macht halten konnten. Die Arbeit ist als eine der letzten noch bei Roger Sablonier eingereicht worden und knüpft an dessen bahnbrechenden sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Untersuchungen zum Adel in der Ostschweiz an.
Ziel des Autors ist es, eine «Übersichtsdarstellung zum Zürcher Zweig seit der ersten Erwähnung in den Schriftquellen des 13. bis zum Aussterben im frühen 17. Jahrhundert vorzulegen». (10) Unter Berücksichtigung des gesamten regionalen Quellenmaterials soll aufgezeigt werden, «wie es dem Zürcher Freiherrengeschlecht möglich [war], in einem Zeitraum von knapp 400 Jahren mit erheblichen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen, Umwälzungen und Krisen dynastisch zu überleben und seine adlige Stellung zu behaupten, während unzählige Standesgenossen der Region Zürich und Ostschweiz ausstarben, untergingen, verdrängt wurden oder der Not gehorchend ins Ausland abwanderten». (10)
Die Arbeit ist chronologisch aufgebaut und widmet jedem Jahrhundert ein gleich strukturiertes Kapitel: Zuerst wird das jeweilige historische Umfeld knapp umrissen; es folgen Erläuterungen zur Genealogie, zu Beziehungsnetzen und Besitzverhältnissen sowie zu weltlichen und geistlichen Karrieren. Ein solches analytisches Vorgehen erscheint einleuchtend und sinnvoll; allerdings werden dadurch Themenstränge wie Wirtschaftsführung oder Herrschaftsausübung zerstückelt, was zur Folge hat, dass im Text häufig hin und her verwiesen werden muss.
Verfolgt man die Geschichte der Herren von Bonstetten über die Jahrhunderte, werden charakteristische Veränderungen fassbar, die Baumeler in den Kapitelüberschriften auf den Punkt zu bringen sucht. So bedeutete das 13. Jahrhundert für das kleine und eher unbedeutende Freiherrengeschlecht unklarer Herkunft den «Aufstieg zu Vertrauten der ersten Habsburger Könige». (31) Im Namen Habsburgs amtierten mehrere Familienmitglieder als Vizelandgrafen, Reichsvögte, Land- und Hofrichter. Im Kontrast zu dieser politischen Bedeutung war der Besitz der Herren von Bonstetten eher klein; neben Gütern in der Gegend des mutmasslichen «Stammsitzes» am Albis verfügten sie offenbar schon früh über die Burg Uster am Greifensee. Als Grablege diente das Kloster Kappel.
Im 14. Jahrhundert scheint es zu einem Bruch in der Genealogie und zum Verlust der Freiherrenwürde gekommen zu sein. Eine Folge davon war, dass Heiratsbeziehungen nicht mehr mit Vertretern des Hochadels eingegangen wurden, sondern nur noch mit ritteradligen oder bürgerlich-städtischen Familien. Möglicherweise
hatte in dieser Zeit ein Zweig der ritter-
adligen Familie Landenberg Namen und Wappen von Bonstetten sowie die damit verbundenen Herrschaftsrechte übernommen. Die Burg Uster wurde nun zum Zentrum der (neuen?) Herren von Bonstetten, die sich fortan wie die Landenberger in der Kirche Uster bestatten liessen. Wie die Landenberger trifft man die Bonstetter schliesslich als Kriegsunternehmer und Kreditgeber wieder unter den «Gefolgs-
leuten der Herzöge von Habsburg». (67)
Sempacherwirren und Appenzellerkrieg machten zu Beginn des 15. Jahrhunderts eine politische Neuorientierung notwendig: Da Habsburg offenkundig keinen ausreichenden Schutz mehr zu bieten vermochte, traten die Bonstetter 1407 ins Burgrecht der Stadt Zürich und mutierten «von habsburgischen Adligen zu adligen Eidgenossen». (127) Besonders deutlich zum Ausdruck kommt dies wiederum in der Heiratspolitik: Statt mit habsburgischen Ministerialen wurden Ehen nun vor allem mit städtischen Patrizierfamilien aus Zürich und Bern geschlossen. Während Andres Roll von Bonstetten sich als eidgenössischer Söldnerführer und Kriegsherr einen Namen machte, pflegte sein Bruder Albrecht als Dekan des Klosters Einsiedeln seine Kontakte zu Staatsmännern und humanistischen Geistesgrössen im In- und Ausland. Noch kaum bekannt war bisher, wie stark sich der Gelehrte für die eigene Familie eingesetzt hat. So war er es, der 1498 bei Kaiser Maximilian die erneute Erhebung in den Freiherrenstand bewirkte. In diesem Zusammenhang dürften einige der familiären Legenden entstanden sein, die den Blick auf die Bonstetter Genealogie bis heute prägen.
Im 16. Jahrhundert geriet die kleine Gerichtsherrschaft in Uster zunehmend in Bedrängnis: Einerseits beanspruchte die Zürcher Obrigkeit immer mehr Kompetenzen für sich, andererseits verweigerten die Untertanen verschiedentlich ihre Abgaben und Dienste. In einem undurchsichtigen Prozess verloren die jugendlichen Bonstetter Erben die Herrschaft Uster 1534 an ihren Schwiegeronkel Ludwig von Diesbach, der sie kurz darauf der Stadt Zürich verkaufte. Die jungen Bonstetter zogen in die Stadt und stiegen ins Rentengeschäft ein; es erfolgte der Übergang «vom Landadligen zum regimentsfähigen adligen Stadtbürger». (197) Junker Jost gelang schliesslich 1568 der Einstieg in die städtische Ämterlaufbahn: Er wurde Ratsherr, Hauptmann sowie Landvogt in den eidgenössischen Untertanengebieten. Auf diese Weise partizipierte das Adelsgeschlecht weiterhin an der politischen Macht im Zürcher Stadtstaat und in der Eidgenossenschaft. Da Jost aber keine Nachkommen hatte, erlosch der Zürcher Zweig bei seinem Tod im Jahr 1606, während sich in Bern eine heute noch existierende Seitenlinie etablierte, die Baumeler allerdings nicht weiterverfolgt.
Die Perspektive der longue durée macht deutlich, wie eng das Schicksal von lokalen Herrschaftsträgern verbunden war mit demjenigen der Landesherrschaft. Dass die Herren von Bonstetten es schafften, sich an die erheblichen politischen, aber auch wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen anzupassen, macht das Geschlecht zu einer «Ausnahmeerscheinung», (235) wie Baumeler bilanzierend festhält. Als «Erfolgsgeheimnis» (237) nennt er eine geschickte Heiratspolitik sowie die erfolgreiche Erschliessung neuer Einkünfte – neben der wohl wenig einträglichen Gerichtsherrschaft vor allem der Solddienst und schliesslich das Rentengeschäft. Daneben spielten aber sicher auch Faktoren eine Rolle, die sich nur bedingt kontrollieren liessen, etwa dass das Geschlecht eher kinderarm war: Mit nur ein bis zwei männlichen Vertretern pro Generation konnte die Familie ihren Besitz zusammenhalten und musste nur selten in kostspielige Klerikerkarrieren für «überzählige» Söhne und Töchter investieren.
Mag man da und dort den Anschluss an aktuelle Forschungsfragen vermissen, so wird Baumelers Werk doch dem Anspruch, eine «Übersichtsdarstellung» zu bieten, voll gerecht. Die angenehme Sprache, der flüssige Stil, die sorgfältige Redaktion sowie konzise und gut verständliche Erläuterungen sorgen dafür, dass sich die faktenreiche Lektüre auch für ein interessiertes Laienpublikum eignet. Abgerundet wird die Arbeit durch einen umfangreichen Anhang mit Tabellen, Karten und Stammbäumen sowie farbigen Abbildungen von Wappendarstellungen und Urkunden.
Rainer Hugener (Zürich) in Traverse